Der zwölfjährige Jesus im Tempel
Predigt über Lukas 2,40-52 zum 2. Sonntag nach Weihnachten 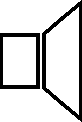
Liebe Brüder und Schwestern in Christus!
Die Geschichte vom zwölfjährigen Jesus im Tempel ist die einzige biblische Geschichte, in der wir etwas aus der Jugendzeit unseres Herrn erfahren. Ansonsten schweigt die Bibel über den Lebensweg Jesu zwischen seinem ersten und dreißigsten Lebensjahr. Die Geschichte ist wohl den meisten von uns vertraut. Jeder, der ein paar biblische Geschichten kennt, kennt auch die Geschichte vom zwölfjährigen Jesus im Tempel. Manche von uns haben sie sicher schon im Kindergottesdienst gehört. Trotzdem ist es eine schwierige Geschichte. Schwierig ist zu verstehen: Warum tut Jesus das seinen Eltern an, warum ängstigt er sie so? Und warum bittet er seine Eltern am Ende nicht einmal und Entschuldigung, sondern konfrontiert sie beinahe schroff mit der Frage: „Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist“? Wie passt das zum perfekt sündlosen Gottmenschen Jesus Christus? Wie passt das zum vierten Gebot: „Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren“? Wir wollen diesen Fragen nachgehen, wenn wir das Ereignis jetzt genauer bedenken. Lasst uns das in zwei Schritten tun. Erstens: Was lehrt uns die Geschichte über Jesus? Zweitens: Was lehrt uns die Geschichte über uns selbst?
Erstens lehrt uns die Geschichte etwas über Jesus. Da wollen wir zunächst auf die beiden Sätze achten, die diese Geschichte einrahmen und die einander sehr ähnlich sind. Vor der Geschichte steht der Satz: „Das Kind wuchs und wurde stark, voller Weisheit, und Gottes Gnade war bei ihm.“ und nach der Geschichte steht der Satz: „Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen.“ Beide Sätze sagen etwas über die kindliche Entwicklung Jesu, sowohl körperlich als auch geistig-seelisch als auch in seiner Beziehung zu den Mitmenschen. Diese Sätze sagen: Jesus hat sich genauso wie ein anderes Menschenkind entwickelt, und er hat sich durch Gottes Gnade in jeder Hinsicht gut entwickelt. Da sehen wir, dass Jesus wirklich voll und ganz Mensch war; es war nicht so, dass sich Gott einfach nur als Kind verkleidet hätte. Jesus ist körperlich und geistig gewachsen, er hat ein Bewusstsein entwickelt, er hat gelernt, er ist gereift, er hat die Welt um sich herum mit offenen Augen und Ohren wahrgenommen.
Die Geschichte vom zwölfjährigen Jesus im Tempel ist nun gewissermaßen eine Momentaufnahme aus dieser kindlichen Entwicklung. Wir können sie als Beispiel ansehen für seine gesamte Entwicklung vom Säugling bis zum Mann. Er ist inzwischen groß genug, um die dreitägige Reise von Nazareth nach Jerusalem zu Fuß zu bewältigen. Er ist alt genug, um nicht mehr an der Hand der Eltern zu gehen, sondern in seiner Clique, also zusammen mit gleichaltrigen Verwandten und Freunden, die alle auch zu dem jährlichen Passafest nach Jerusalem pilgern. So erklärt es sich, dass seine Eltern auf dem Rückweg zunächst einen ganzen Tag unbesorgt reisten, obwohl sie ihren Sohn gar nicht zu Gesicht bekamen. Mit zwölf Jahre mussten damals viele Jugendliche schon voll ihren Mann stehen und sogar einen Arbeitsplatz ausfüllen. Auch der zwölfjährige Jesus wird schon wie ein Lehrling seinem Vater, dem Zimmermann, beim Häuser-Bauen geholfen haben.
Im Gespräch mit den Schriftgelehrten im Tempel begegnet Jesus uns als wissbegieriger Teenager: Er sitzt bei ihnen, hört zu, stellt Fragen, beantwortet seinerseits die Fragen der Lehrer und beteiligt sich rege an dem Glaubensgespräch, das da geführt wird. Dass dabei die Rückreise mit den Eltern in den Hintergrund tritt, ist auch typisch für einen Teenager, denn es gehört zur natürlichen Entwicklung, dass sich Kinder in diesem Alter von ihren Eltern lösen. Das Bewusstsein für das eigene Ich wächst, für den eigenen Willen und für die eigene Persönlichkeit, losgelöst vom Elternhaus. Alles das ist ganz natürlich und menschlich. Es ist auch richtig so, es ist keine Missachtung des vierten Gebots – selbst wenn manche christlichen Eltern das so empfinden bei ihren großen Kindern. Jesus konnte die Aufregung seiner Eltern gar nicht verstehen darüber, dass er noch ein bisschen im Tempel geblieben ist, und das ist ganz normal für einen Zwölfjährigen.
Einzigartig ist dabei etwas anderes – und da erkennen wir, wie mit dem wahren Menschen Jesus, dem ganz normalen Teenager, der wahre Gott verbunden ist. In Jesus war zu diesem Zeitpunkt nämlich das Bewusstsein erwacht, dass er Gottes Sohn ist. Er begründet seinen verlängerten Aufenthalt im Tempel mit den Worten: „Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist?“ Dieser Satz, diese rhetorische Frage ist das Wichtigste in der ganzen Geschichte. Da tritt nämlich bei der menschlichen Entwicklung seine göttliche Natur hervor. Jesus sagt hier bewusst „mein Vater“, nicht „unser Vater“, wie es alle Menschen sagen können, die an ihn glauben. Indem er sagt „mein Vater“, zeigt er, dass ihm jetzt klar geworden ist: Er ist der eingeborene Sohn Gottes; er ist in einzigartiger Weise Gottes Kind, anders als die anderen Menschen. Darum gehört er auch eher in Gottes Tempel als in das Haus des Zimmermanns in Nazareth. „Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist?“, fragt er seine Eltern. In dem Wörtchen „muss“ verbirgt sich ein göttlicher Auftrag, da ist er Gehorsam schuldig. Er muss hier im Tempel mit den Schriftgelehrten studieren und die Bibel immer besser kennenlernen, das will sein Vater im Himmel so. Und da merken wir: Sein Verbleiben im Tempel ist kein Akt des Ungehorsams gegen seine irdischen Eltern, sondern ein Akt des größeren Gehorsams gegen seinen himmlischen Vater. Jesus sündigt hier nicht, wie er ja überhaupt ganz sündlos ist, sondern er erfüllt das Gebot: „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“ (Apostelgesch. 5,29). Für ihn als Gottes eingeborenen Sohn bedeutet dies, dass er als Zwölfjähriger noch eine Weile im Tempel zurückbleiben muss. Er geht dann aber willig mit seinen Eltern wieder zurück nach Nazareth, und es ist ausdrücklich berichtet, dass er ihnen untertan ist. So lehrt uns diese Geschichte, dass Jesus auch in seinem Entwicklungsjahren ganz Mensch und ganz Gott ist. Auch die große Weisheit, mit der er im Gespräch mit den Schriftgelehrten antwortet, zeigt etwas von seiner göttlichen Natur.
Wir kommen nun zum zweiten Schritt der Betrachtung und fragen, was wir denn für unser eigenes Leben aus dieser Geschichte lernen können. Da wollen wir auf das Verhalten der Eltern Jesu achten, besonders aber auf Marias Verhalten. Ich finde, Jesu Eltern verhalten sich großartig, geradezu vorbildlich. Es ist vorbildlich, dass sie mit ihrem Sohn zum Gottesdienst gehen, zum Passafest im Tempel. Es ist ein Jammer, dass heute viele christliche Eltern an dem Punkt nachlässig sind und nur ganz selten mit ihren Kindern zur Kirche gehen. Selbst zu den großen Festen bleiben viele lieber zu Hause, besuchen Freunde oder machen Urlaub. Und zu Weihnachten denken viele, mit dem Besuch des kurzen Heiligabend-Gottesdienstes hätten sie schon genug getan, und bleiben dann mit ihren Kindern am 1. und 2. Feiertag der Kirche wieder fern. Dagegen blieben Jesus und Maria mit Jesus mehrere Tage lang beim Passafest in Jerusalem! Vorbildlich ist es auch, dass Maria und Josef nicht ängstlich an ihrem zwölfjährigen Sohn kleben, sondern ihm schon seine altersgemäße Freiheit lassen und sich nicht zuviel um ihn sorgen. Sie werden sich bei der Rückreise gesagt haben: Unser Jesus ist wohl mit seinen Freunden schon voraus gegangen; sollen die jungen Burschen doch ein bisschen Spaß miteinander haben! Sie ließen Jesus an der „langen Leine“ laufen, wie man so sagt, und das war für sein Alter genau richtig. Vorbildlich ist aber auch, dass sie diese „Leine“ nicht ganz losließen, sondern nach einem Tag doch begannen, sich nach ihm zu erkundigen. Maria und Josef waren nicht dickfällig, es war ihnen durchaus nicht egal, wo Jesus war. Und darum machten sie sich schließlich auch unter zunehmenden Sorgen auf den Weg nach Jerusalem zurück. Sie hofften, dass sie ihn dort finden oder zumindest seine Spur aufnehmen konnten. Vorbildlich ist schließlich, was Maria sagte, als sie Jesus im Tempel wiederfand. Sie sagte: „Mein Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht.“ Maria schimpft nicht einfach los, aber sie tut auch nicht so, als sei nun alles in Ordnung. Sie gewährt ihrem großen, verständigen Sohn Einblick in ihr Herz, sie wirbt um Verständnis: „Wir haben dich mit Schmerzen gesucht.“ Es ist eine feine Erziehung, die hier deutlich wird. Wie gut ist es, wenn Eltern ihre Kinder nicht einfach nur herumkommandieren, sondern ihnen helfen, andere Menschen zu verstehen, sich in sie hineinzuversetzen! Ja, so weit handelt Maria mit Josef vorbildlich bei diesem Ereignis.
Aber wir können noch mehr von ihnen lernen, über ihr elterliches Vorbild hinaus. Wir sehen nämlich an dieser Geschichte, dass sie an ihrem Kind leiden. „Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist?“, sagte Jesus. Der Schmerz darüber, dass Jesus nicht bei ihnen ist, dass er seine eigenen Wege geht, der muss sein. Ein göttliches Muss steckt dahinter, ein Muss vom himmlischen Vater. Und das ist ja keineswegs das einzige Herzeleid, das Jesus seiner Mutter zumutete. Als er erwachsen war und lehrend umherzog, da mutete er ihr starke Zweifel zu, denn sie dachte zu der Zeit: Jetzt ist Jesus übergeschnappt, jetzt ist er verrückt geworden. Und dann mutete er ihr zu, unter seinem Kreuz zu stehen und ihn unsäglich leiden zu sehen. Und dann mutete er ihr schließlich sogar zu, ihn zu Grabe tragen zu müssen. Wir, liebe Brüder und Schwestern, lernen daraus: Jesus mutet uns Menschen allerhand zu. Sein Heilsweg ist ein Weg des Kreuzes – nicht nur für ihn, sondern auch für alle, die ihn begleiten. So mussten bereits seine Eltern leiden, und dann die Apostel, und dann alle Jünger bis zum heutigen Tag. Wer nicht bereit ist, mit Jesus und an Jesus zu leiden, der kann nicht sein Jünger sein. Ja, das lernen wir mit Maria und Josef, die an ihrem zwölfjährigen Sohn litten. Aber er wollte ihnen nicht weh tun, sondern es musste alles so geschehen zum Heil der Welt. Auch wir sollen unser Kreuz tragen in dem Wissen: Gott will uns nicht weh tun, aber es muss so geschehen, es ist zu unserem Besten und nötig für das Heil.
Ja, und dann werden uns Maria und Josef schließlich auch noch zu schlechten Vorbildern in dieser Geschichte. Als Jesus ihnen gesagt hatte: „Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist?“, da heißt es von ihnen: „Sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte.“ Sie verstanden nicht, was ihr Sohn ihnen offenbarte. Sie verstanden nicht, dass er in erster Linie und einzigartiger Weise Gottes Sohn war, ihnen, den irdischen Eltern, nur zur Pflege anvertraut. Sie verstanden nicht das göttliche Muss seines Weges, den er zu gehen hatte, auch wenn der für seine Eltern und für ihn selbst schmerzhaft war. Wir können auch sagen: Sie glaubten nicht! Hätte Maria sich doch an das erinnert, was der Engel ihr zu Beginn ihrer Schwangerschaft gesagt hatte: „Er wird Sohn des Höchsten genannt werden“ (Lukas 1,32). Hätte sie doch den Worten der Hirten geglaubt, die ihr von der Botschaft des Engels berichtet hatten: „Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr“ (Lukas 2,11). Sie hatte doch alle diese Worte behalten und in ihrem Herzen bewegt. Hätte sie doch dem alten Simeon geglaubt, der ihr damals im Tempel den Säugling aus dem Arm genommen hatte und ausgerufen: „Meine Augen haben deinen Heiland gesehen“ (Lukas 2,30). Aber nun glaubte sie nichts, nun verstand sie nichts. Wir wissen dass Maria erst nach Ostern wieder richtig zum Glauben gefunden hat, erst nach der Auferstehung Christi. Vorher hat sie ihren Sohn zwar mit Liebe begleitet, aber auch mit dem Unverständnis des Unglaubens.
Ach, dass wir doch im Glauben bleiben! Auch dann, wenn uns Jesu Worte menschlich gegen den Strich gehen. Auch dann, wenn wir vieles nicht verstehen von den Worten der Bibel. Wenn wir aber im Glauben bleiben, dann dürfen wir wissen: Durch Jesus gehören auch wir zum himmlischen Vater. Er ist unser Vater im Himmel, und das ist noch wichtiger als unser irdisches Elternhaus, unsere gesamte Verwandtschaft und unser Freundeskreis. Das Reich des Vaters im Himmel soll uns am wichtigsten sein, Gott muss an erster Stelle stehen. Jesus hat es später seine Jünger gelehrt: Wer Vater oder Mutter oder Mann oder Frau oder Kinder lieber hat als Gott, der kann nicht sein Jünger sein. Ja, auch wir müssen in unseres Vaters Haus sein, das will unser Vater so. Zwar leben wir in zwei Welten, in dieser vergänglichen Welt und auch seit der Taufe in Gottes Reich, aber Gottes Reich muss uns das wichtigere sein. Darum ist es ja auch so wichtig, dass wir hier im Gottesdienst zusammenkommen als Gottes Familie, als Brüder und Schwestern im Herrn. Darum ist es so wichtig, dass wir hier Sonntag für Sonntag den Feiertag heiligen. Darum ist es so wichtig, dass wir uns hier vom himmlischen Vater lehren und dienen lassen mit seinem heiligen Wort und durch das Heilige Abendmahl. Und wenn eine innere Stimme da Zweifel säen will, oder wenn andere Menschen das für übertrieben halten, oder wenn wir meinen, wir haben keine Zeit dazu, dann sollten wir diesen Stimmen so antworten, wie der Herr Jesus selbst seinen Eltern antwortete, als er zwölf Jahre alt war: „Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist?“ Amen.